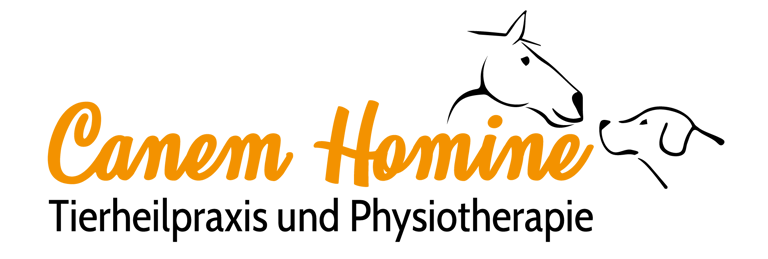Soll ich oder soll ich nicht? Die Kastration deines Hundes
Kastration beim Hund: Der Eingriff, der nicht nur das Geschlecht, sondern auch so manche Erwartung auf den Kopf stellt. Lass uns herausfinden, ob das Schnipp-Schnapp wirklich der Schlüssel zum friedlichen Zusammenleben ist oder ob wir da vielleicht etwas übersehen haben!“
THP Nicole Hempel


Schnipp, Schnapp oder was?
Die Entscheidung für oder gegen eine Kastration ist für viele Hundehalter kein Spaziergang im Park. Mit einem einzigen Eingriff sollen lästiges Markieren, die plötzlichen Frühlingsgefühle beim Anblick der Nachbarshündin oder das Aufreiten beim Gassigehen ein Ende finden – das klingt für viele verlockend. Doch bevor die Wahl für oder gegen eine Kastration endgültig fällt, ist es ratsam, die Dinge etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die neuesten Studien zeigen: Die Kastration hat tiefgreifende Auswirkungen, die sich nicht nur auf die Fruchtbarkeit beschränken, sondern den ganzen Organismus deines Hundes betreffen. Hormone wie Testosteron und Östrogen sind dabei für weit mehr verantwortlich als nur für den Fortpflanzungstrieb. Sie steuern unter anderem den Stoffwechsel, die Knochengesundheit und sogar das Verhalten. Das heißt, es gibt einiges zu bedenken, bevor dieser Schritt gewagt wird – und genau das schauen wir uns jetzt in aller Ruhe und Klarheit an.
Was passiert bei der Kastration?
Bevor wir uns mit den Risiken und neuen Studien beschäftigen, schauen wir uns kurz an, was bei einer Kastration eigentlich genau passiert.
Kastration bei Rüden:
Bei Rüden bedeutet die Kastration, dass beide Hoden operativ entfernt werden. Dadurch wird die Produktion des Hormons Testosteron dauerhaft gestoppt, und der Hund wird unfruchtbar. Viele Halter erwarten sich durch diesen Eingriff eine Verhaltensänderung: weniger territoriales Markieren, weniger Aggression und weniger „unaufgeforderte Liebesbekundungen“. Doch ganz so einfach ist es nicht! Die Hart-Studie zeigt, dass diese erhoffte Verhaltensänderung in den meisten Fällen nicht eintritt und die Annahme, dass Kastration aggressives Verhalten generell mindert, mittlerweile weitgehend widerlegt ist.
Kastration bei Hündinnen:
Bei Hündinnen umfasst die Kastration normalerweise die Entfernung von Eierstöcken und Gebärmutter. Dies führt nicht nur zur Unfruchtbarkeit, sondern verhindert auch die Läufigkeit. Viele entscheiden sich für die Kastration, um das Risiko für gesundheitliche Probleme wie Gebärmuttervereiterungen oder Brustkrebs zu senken. Allerdings zeigen neuere Erkenntnisse, dass die Kastration das Risiko für bestimmte Krebsarten sogar erhöhen kann, darunter – Überraschung! – Brustkrebs.
Was passiert mit den fehlenden Hormonen?
Wenn wir Hormone hören, denken die meisten vielleicht nur an die Fortpflanzung – aber weit gefehlt! Testosteron und Östrogen haben im Körper von Hunden deutlich mehr zu tun als nur für Nachwuchs zu sorgen. Sie sind wie die Dirigenten eines Orchesters, das den gesamten Stoffwechsel, das Immunsystem und sogar die Knochendichte im Takt hält. Ein abrupter Stopp dieser Hormonproduktion kann also einiges durcheinanderbringen.
Auswirkungen des Testosteronverlustes bei Rüden:
Ohne Testosteron steht der Muskelaufbau plötzlich auf Sparflamme, und auch der Fettstoffwechsel bekommt seine Aufgaben nicht mehr so recht geregelt. Was passiert? Der Hund baut weniger Muskeln auf, speichert schneller Fett und neigt dadurch zu Übergewicht. Die Folge davon kann eine Belastung der Gelenke sein, die dann vermehrt zum Einsatz kommen müssen, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Die Muskulatur und die Knochenmasse schwinden also langsam, und die Gelenke müssen das ausgleichen. Einige Rüden sehen nach einer Kastration nicht nur etwas „fülliger“, sondern auch regelrecht „weicher“ aus, da die Muskelspannung nachlässt und das Gewebe „sich setzt“. Hinzu kommt, dass der Stoffwechsel oft verlangsamt wird, was Gewichtszunahme und Trägheit verstärken kann. Wer hätte gedacht, dass so ein kleines Organ wie der Hoden so viel Kontrolle hat?
Östrogenmangel bei Hündinnen:
Auch bei Hündinnen hinterlässt der Hormonstopp deutliche Spuren. Östrogen kümmert sich um weit mehr als den Fortpflanzungszyklus – es sorgt für ein gesundes Immunsystem, hält die Haut geschmeidig und unterstützt die Knochengesundheit. Fehlt es, dann kann die Haut trocken und empfindlich werden, das einst glänzende Fell verliert seinen Glanz, und die Hündin wird anfälliger für Hautirritationen. Doch das ist noch nicht alles: Die Knochen werden brüchiger, die Knochendichte sinkt, und das Risiko für Gelenkprobleme steigt. Plötzlich wird aus dem jungen Wirbelwind ein Hund, der vorsichtiger läuft und weniger gern springt. Wer hätte das gedacht? Ein einzelnes Hormon mit so viel Einfluss auf Haut und Knochen.
Auswirkungen auf die Schilddrüse
Die Schilddrüse ist eine Art kleine „Powerbank“ im Körper, die unter anderem den Stoffwechsel, das Wachstum und die Körpertemperatur reguliert. Nach der Kastration ändert sich hier einiges, denn die Geschlechtshormone helfen der Schilddrüse, auf Hochtouren zu laufen. Fehlen sie, wird die Schilddrüse oft „träge“, und eine Schilddrüsenunterfunktion – auch Hypothyreose genannt – kann die Folge sein.
Was bedeutet das konkret?
Ohne ausreichend Schilddrüsenhormone verliert dein Hund buchstäblich an Schwung. Gewichtszunahme ist nur ein erster Hinweis, meist gefolgt von Müdigkeit, stumpfem Fell, Hautproblemen und manchmal sogar Haarausfall. Besonders auffällig ist dabei oft die Veränderung im Verhalten – der einst quirlige Hund wird gemütlicher, fast schon lethargisch, und reagiert weniger freudig auf die einst geliebten Gassirunden. Als würde die Batterie nicht mehr voll aufgeladen werden. Das komplexe Zusammenspiel von Schilddrüse und Geschlechtshormonen zeigt, wie wichtig ein harmonisches Hormonumfeld für die Vitalität deines Hundes ist.
Gelenkerkrankungen nach Kastration
Die Hart-Studie zeigt, dass besonders große Rassen wie Golden Retriever, Labrador und Deutsche Schäferhunde anfällig für Gelenkprobleme sind, wenn sie zu früh kastriert werden. Die Kastration greift so früh in den Wachstumsprozess ein, dass die Gelenke und Knochenstrukturen sich nicht mehr richtig entwickeln können. Hüftdysplasie und Kreuzbandrisse kommen bei kastrierten Riesen wie diesen besonders häufig vor – und das oft schon im jungen Alter.
Was steckt dahinter? Ohne Geschlechtshormone wachsen die Knochen zwar weiter, aber sie bleiben oft zu „weich“. Die Muskulatur, die eigentlich das Skelett stabilisieren sollte, wird weniger aufgebaut, und die Gelenke tragen die Hauptlast. Viele Hunde entwickeln so einen unnatürlichen Gang, und überbeanspruchte Gelenke melden sich mit schmerzhaften Beschwerden. Für Halter bedeutet das oft regelmäßige Tierarztbesuche, Spezialfutter, Gelenkpräparate und manchmal sogar Operationen, die im besten Fall nur Linderung, aber selten vollständige Heilung bringen. Ein Grund mehr, besonders bei großen Rassen genau zu überlegen, wann – und ob – der Eingriff sinnvoll ist.
Das steigende Krebsrisiko
Eine der schockierenden Erkenntnisse aus der Hart-Studie betrifft das erhöhte Krebsrisiko nach der Kastration. Besonders bei bestimmten Rassen wie Dobermännern und Golden Retrievern steigt die Wahrscheinlichkeit für Krebsarten wie Lymphome und Hämangiosarkome. Auch Rottweiler und Boxer haben ein deutlich höheres Risiko für Knochen- und Weichteiltumore nach einer frühen Kastration.
Die Erklärung liegt wieder in den Hormonen: Diese unterstützen das Immunsystem dabei, entartete Zellen zu kontrollieren und Tumorwachstum in Schach zu halten. Werden sie früh entfernt, verliert das Immunsystem diese Unterstützung. Die Kastration in einem Alter, in dem das Immunsystem noch nicht ausgereift ist, kann das Risiko, dass entartete Zellen überhandnehmen, deutlich erhöhen. Was früher als Schutzmaßnahme vor Brustkrebs betrachtet wurde, entpuppt sich nun als Trugschluss – bei manchen Rassen steigt das Risiko sogar nach der Kastration.
Harninkontinenz bei Hündinnen
Auch wenn es erst einmal harmlos klingt: Harninkontinenz, das unkontrollierte „Tröpfeln“, ist für Hündinnen und ihre Halter kein kleines Problem. Vor allem bei einer frühen Kastration wird die Wahrscheinlichkeit für Harninkontinenz deutlich erhöht. Ohne die Unterstützung der Geschlechtshormone verliert der Blasenmuskel oft an Spannkraft, und die Harnwege werden empfindlicher. Der erste Auslöser kann ein kleiner Sprung oder eine aufregende Situation sein, und schon zeigt sich ein feuchter Fleck – für viele Hunde und Besitzer eine Quelle von Frustration.
Betroffene Hündinnen brauchen oft lebenslang Medikamente, die den Blasenschlussmuskel stärken sollen. Doch die Behandlung ist nicht bei allen Hunden erfolgreich, und für einige bedeutet das, dass sie ihren Alltag – und den ihres Menschen – dauerhaft verändern müssen. Harninkontinenz mag in der Liste der Kastrationsfolgen unscheinbar wirken, ist jedoch für die betroffenen Hunde und ihre Besitzer ein großes Thema.
„Vor der Kastration deines Hundes, lass das Wissen sprudeln! Dieses Buch ist dein unverzichtbarer Begleiter, damit du mit einem Augenzwinkern und klarem Verstand entscheidest, ob es Zeit für den „Schnipp-Schnapp“ ist!“
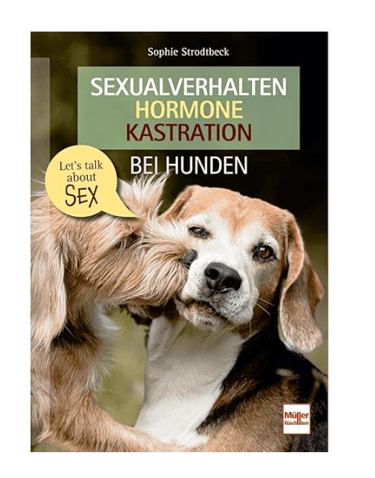
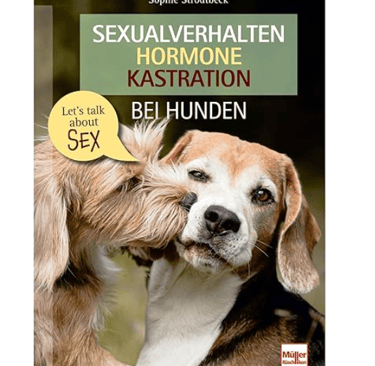

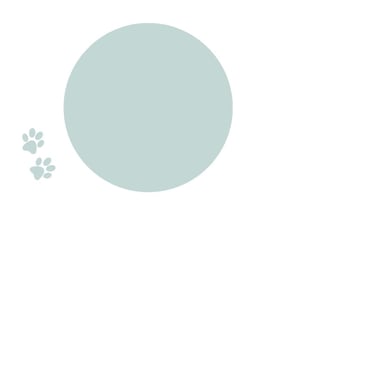

Was würde dein Hund wohl zu einer Kastration sagen, wenn er mit entscheiden dürfte?
Chemische Kastration: Der „Testlauf“ mit Nebenwirkungen
Für Halter, die sich unsicher sind, ob eine dauerhafte Kastration das Richtige für ihren Hund ist, kann die chemische Kastration eine Option sein. Dabei wird ein Hormonimplantat eingesetzt, das über mehrere Monate die Produktion von Testosteron oder Östrogen unterdrückt – ohne Operation und mit der Möglichkeit, die Wirkung nach Abklingen des Implantats wieder aufzuheben. Doch obwohl diese Methode auf den ersten Blick weniger invasiv wirkt, sind auch hier einige Nebenwirkungen möglich.
Verhaltensveränderungen: Wenn der Hormonabfall zur Herausforderung wird
Bei der chemischen Kastration fällt der Hormonspiegel plötzlich ab, und das kann für den Hund ungewohnt und verwirrend sein. Besonders Hunde, die bereits vorher zu Unsicherheit oder Ängstlichkeit neigen, können durch den plötzlichen Mangel an stabilisierenden Hormonen wie Testosteron verunsichert werden. Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass in einigen Fällen Hunde mit aggressivem Verhalten oder starker Territorialität durch den Hormonabfall sogar noch reaktiver und angespannt werden. Der „Testlauf“ wird dann zum echten Test für Hund und Halter, die oft überrascht sind, wie unterschiedlich Hunde auf diese hormonellen Veränderungen reagieren können.
Körperliche Nebenwirkungen und das Risiko von Gewichtszunahme
Ein weiterer Faktor, der bei der chemischen Kastration häufig auftritt, ist eine Veränderung im Stoffwechsel. Der plötzlich reduzierte Hormonspiegel kann den Energieumsatz verlangsamen, wodurch der Hund leichter Gewicht zunimmt. Gerade bei Hunden, die ohnehin zu einem etwas kräftigeren Körperbau neigen, kann dies schnell zu Übergewicht führen. Für Halter bedeutet das oft, die Futtermenge anzupassen und verstärkt auf Bewegung zu achten, um ungewollte Pfunde in Schach zu halten.
Hautreaktionen und allergische Reaktionen: Wenn das Implantat stört
Hormonimplantate können an der Einsetzungsstelle im Gewebe zu Reizungen führen. Manche Hunde entwickeln an der Stelle eine Rötung, Schwellung oder – in selteneren Fällen – sogar eine allergische Reaktion. Diese kann lokal begrenzt sein, aber in einigen Fällen treten systemische Reaktionen auf, die eine sofortige tierärztliche Behandlung erforderlich machen. Solche Reaktionen sind selten, aber nicht ausgeschlossen, und können für Hund und Halter zu einer unerwarteten Belastung werden.
Unvorhersehbare Wirkungsdauer: Ein unsicherer Faktor
Die chemische Kastration wird häufig als vorübergehender Eingriff angepriesen, dessen Wirkung nach einigen Monaten nachlässt. Doch die genaue Wirkungsdauer kann variieren. Während einige Hunde die Hormonunterdrückung über die erwartete Dauer von sechs Monaten beibehalten, kann bei anderen die Wirkung früher nachlassen oder sogar länger anhalten. Diese Unsicherheit macht die chemische Kastration manchmal weniger berechenbar als die chirurgische Variante. Wenn die Wirkung unerwartet nachlässt, kann das Verhalten wieder in alte Muster zurückfallen – inklusive Territorialverhalten, Markieren und „Liebesbekundungen“ an läufige Hündinnen.
Langzeitwirkungen auf die Fruchtbarkeit und das hormonelle Gleichgewicht
Obwohl die chemische Kastration als reversibel gilt, deuten neuere Forschungen darauf hin, dass wiederholte Anwendungen Auswirkungen auf das hormonelle Gleichgewicht und die Fruchtbarkeit haben können. Eine fortlaufende hormonelle Manipulation könnte das Gleichgewicht im Körper des Hundes auf Dauer beeinflussen und möglicherweise die Fähigkeit zur Fortpflanzung dauerhaft einschränken. Auch wird vermutet, dass wiederholte chemische Kastrationen zu metabolischen Problemen führen können, ähnlich wie bei einer chirurgischen Kastration.
Fazit zur chemischen Kastration: Chance oder Risiko?
Die chemische Kastration kann für manche Halter eine sinnvolle Möglichkeit sein, um zu testen, ob eine dauerhafte Kastration für ihren Hund die richtige Entscheidung ist. Doch die Methode ist kein risikofreies Experiment. Neben der Unvorhersehbarkeit der Wirkung können Verhaltensänderungen, Gewichtszunahme und allergische Reaktionen auftreten. Halter sollten sich darüber im Klaren sein, dass auch dieser „Testlauf“ Nebenwirkungen haben kann, die das Verhalten und die Gesundheit des Hundes beeinflussen.
Ob chemische oder chirurgische Kastration: Jede Entscheidung hat Folgen und sollte gut abgewogen werden. Letztlich geht es darum, eine Lösung zu finden, die das Wohlbefinden des Hundes unterstützt und seiner Persönlichkeit gerecht wird.
Das Tierschutzgesetz: Ein Dilemma der Kastration
Das Tierschutzgesetz: Mehr als nur ein "Schnipp-Schnapp"
Das deutsche Tierschutzgesetz spricht eigentlich eine klare Sprache: Das Abtrennen oder Entfernen gesunder Körperteile ist strikt untersagt – und dazu gehört auch die Kastration. Laut § 6 Abs. 1 TierSchG dürfen Körperteile oder Organe nur entfernt werden, wenn ein „vernünftiger Grund“ vorliegt, also ein tatsächliches medizinisches Problem besteht. Die Idee dahinter? Ganz einfach: Tiere sollen nicht unnötig leiden, nur weil es uns das Leben leichter macht. Klingt logisch, oder?
Warum dann trotzdem so viele Kastrationen?
Doch ein Blick in die Praxis zeigt: Die Realität sieht oft anders aus. Viele Tierärzte kastrieren auf Wunsch – ohne dass eine klare medizinische Indikation vorliegt. Ein Schelm, wer hier denkt, dass ein bisschen wirtschaftliches Kalkül dahinterstecken könnte. Natürlich spielen auch die Erwartungen der Halter eine Rolle: Kastration wird oft als „Allheilmittel“ für Verhaltensprobleme angepriesen, sei es das nervige Markieren, das Dominanzgehabe oder schlicht der Wunsch nach einem friedlichen Zusammenleben. Doch machen wir uns nichts vor – oft sind diese Erwartungen zu hoch gesteckt.
Viele Tierärzte sehen sich in einer Zwickmühle: Sie wollen den Wünschen der Tierhalter entgegenkommen und stehen dennoch vor der Herausforderung, das Wohl des Tieres im Auge zu behalten. Dass die meisten Halter nicht wissen, dass der „schnelle Schnitt“ gesetzlich kritisch ist, macht es ihnen oft leicht, die Entscheidung zur Kastration mit einem Achselzucken abzunicken.
Der „vernünftige Grund“ – was soll das eigentlich heißen?
Was im Gesetzestext noch nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Tiergesundheit klingt, ist in der Praxis ein Spielraum für Interpretationen. Der sogenannte „vernünftige Grund“ wird zur flexiblen Floskel, die sich je nach Situation und Motivation der Beteiligten dehnen lässt. Eine medizinische Notwendigkeit ist das eine, aber was ist mit dem Argument der Bequemlichkeit? Gerade bei reinen Verhaltensfragen stellt sich die Frage, ob eine Kastration wirklich gerechtfertigt ist, wenn Alternativen wie Verhaltensmanagement und Erziehung ebenfalls möglich wären – auch wenn sie mehr Einsatz und Geduld erfordern.
Aufklärung? Leider oft Fehlanzeige
Ein weiteres Problem: Vielen Haltern fehlt es an Aufklärung. Statt auf die Nebenwirkungen und Alternativen zur Kastration aufmerksam zu machen, wird der Eingriff oft als unkomplizierte „Lösung“ verkauft. Der Kastrationschip, der eine temporäre Unfruchtbarmachung ermöglicht, wäre ein sanfterer Testlauf – aber wie oft wird dieser wirklich angeboten? Hier könnten Tierärzte eine wichtigere Rolle spielen, indem sie verantwortungsvolle Beratung voranstellt und Alternativen aufzeigen, die dem Wohl des Hundes tatsächlich gerecht werden.
Gesetz und Gewissen
Gesetzlich ist die Lage klar, doch am Ende bleibt die Verantwortung auch beim Halter. Wer wirklich das Beste für seinen Hund will, sollte sich gut informieren und sich nicht für den „einfachen Weg“ entscheiden. Denn am Ende sollten unsere vierbeinigen Freunde mehr verdienen als ein Eingriff, der am eigentlichen Problem oft vorbeigeht.
Die Verantwortung tragen – ganz egal, wie die Entscheidung ausfällt
Am Ende des Tages bedeutet die Entscheidung für oder gegen eine Kastration, Verantwortung zu übernehmen – und zwar in doppelter Hinsicht. Wer sich gegen die Kastration entscheidet, muss auch damit leben, dass es möglicherweise Phasen gibt, in denen der Hund vermehrte Aufmerksamkeit und Erziehung braucht, besonders bei Rüden in Gegenwart von läufigen Hündinnen. Das kann Geduld, Nerven und manchmal ein hohes Maß an Flexibilität erfordern, um das harmonische Zusammenleben zu wahren. Und nicht zu vergessen: Eine ungewollte Schwangerschaft der Hündin kann schnell zum Abenteuer werden, das man nicht unbedingt erleben möchte.
Wer sich für eine Kastration entscheidet, darf sich im Umkehrschluss darüber bewusst sein, dass dieser Eingriff weitreichende gesundheitliche Folgen für das Tier haben kann – von Hormonmangel bis zu möglichen Gelenkproblemen und Verhaltensänderungen. Die Entscheidung, ob mit oder ohne „Schnipp-Schnapp“, ist also nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit oder des „Das macht man so“, sondern ein Abwägen der Konsequenzen und Bedürfnisse des Hundes. Denn letztlich tragen wir die Verantwortung für das Wohl unserer Vierbeiner – in guten wie in schwierigen Zeiten.
Hier ist der Link zum deutschen Tierschutzgesetz, in dem unter §6 das Verbot der Amputation gesunder Körperteile geregelt ist:
Du findest hier die vollständigen rechtlichen Vorgaben und die genauen Formulierungen zur Kastration und weiteren Eingriffen bei Tieren.
Quellen zu den Studien zur Kastration bei Hunden und deren gesundheitlichen Auswirkungen
Urfer, S.R.; Kaeberlein, M. (2019). Desexing Dogs: A Review of the Current Literature. Animals, 9(12), 1086.
Link zur Quelle
Hart, B.L.; Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Willits, N.H. (2014). Long-Term Health Effects of Neutering Dogs: Comparison of Labrador Retrievers with Golden Retrievers. PLoS ONE, 9(7), e102241.
Hart, B.L.; Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Willits, N.H. (2016). Neutering of German Shepherd Dogs: Associated Joint Disorders, Cancers and Urinary Incontinence. Veterinary Medicine and Science, 2(3).
Hart, B.L.; Hart, L.A.; Thigpen, A.P.; Willits, N.H. (2020). Assisting Decision-Making on Age of Neutering for 35 Breeds of Dogs: Associated Joint Disorders, Cancers, and Urinary Incontinence. Front. Vet. Sci. 7:388.
Wehrend, A. (2015). Kastration von Hündinnen: Mit falschen Zahlen operiert. Süddeutsche Zeitung.
Zink, M.C.; Farhoody, P.; Elser, S.E.; Ruffini, L.D.; Gibbons, T.A.; Rieger, R.H. (2014). Evaluation of the risk and age of onset of cancer and behavioral disorders in gonadectomized Vizslas. JAVMA, 244(3).
Link zur Quelle
Bolliger, G.; Goetschel, A.F.; Richner, M.; Spring, A. (2008). Tier im Recht Transparent. Schulthess Juristische Medien AG.
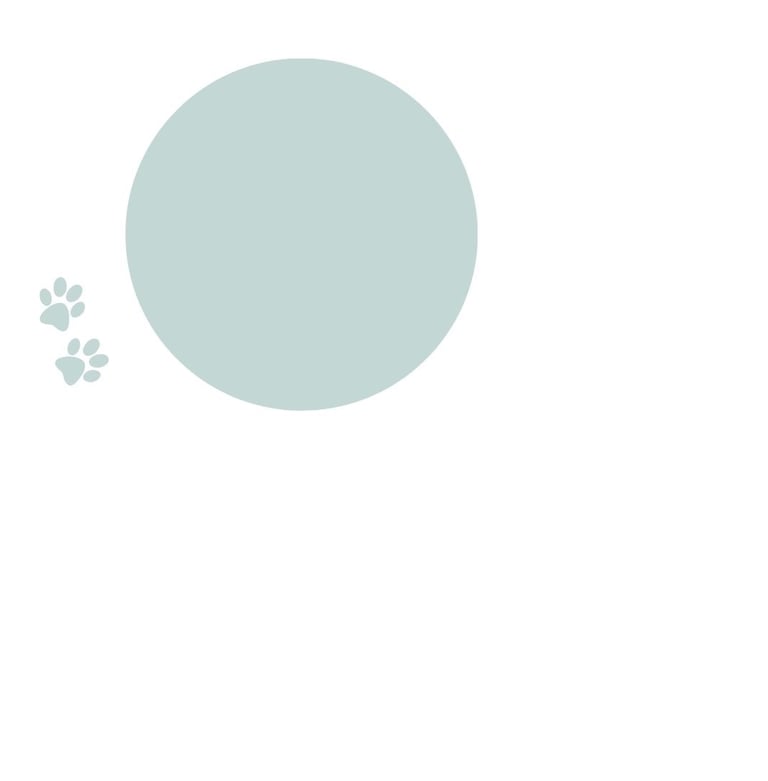
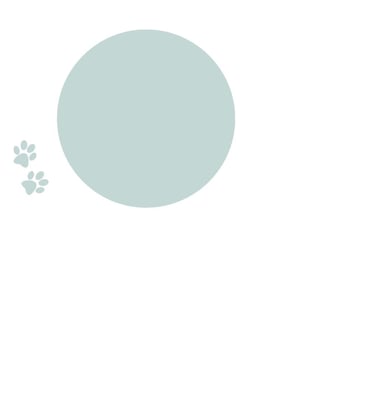
Tierheilpraxis & Ernährungsberatung
Nicole Hempel